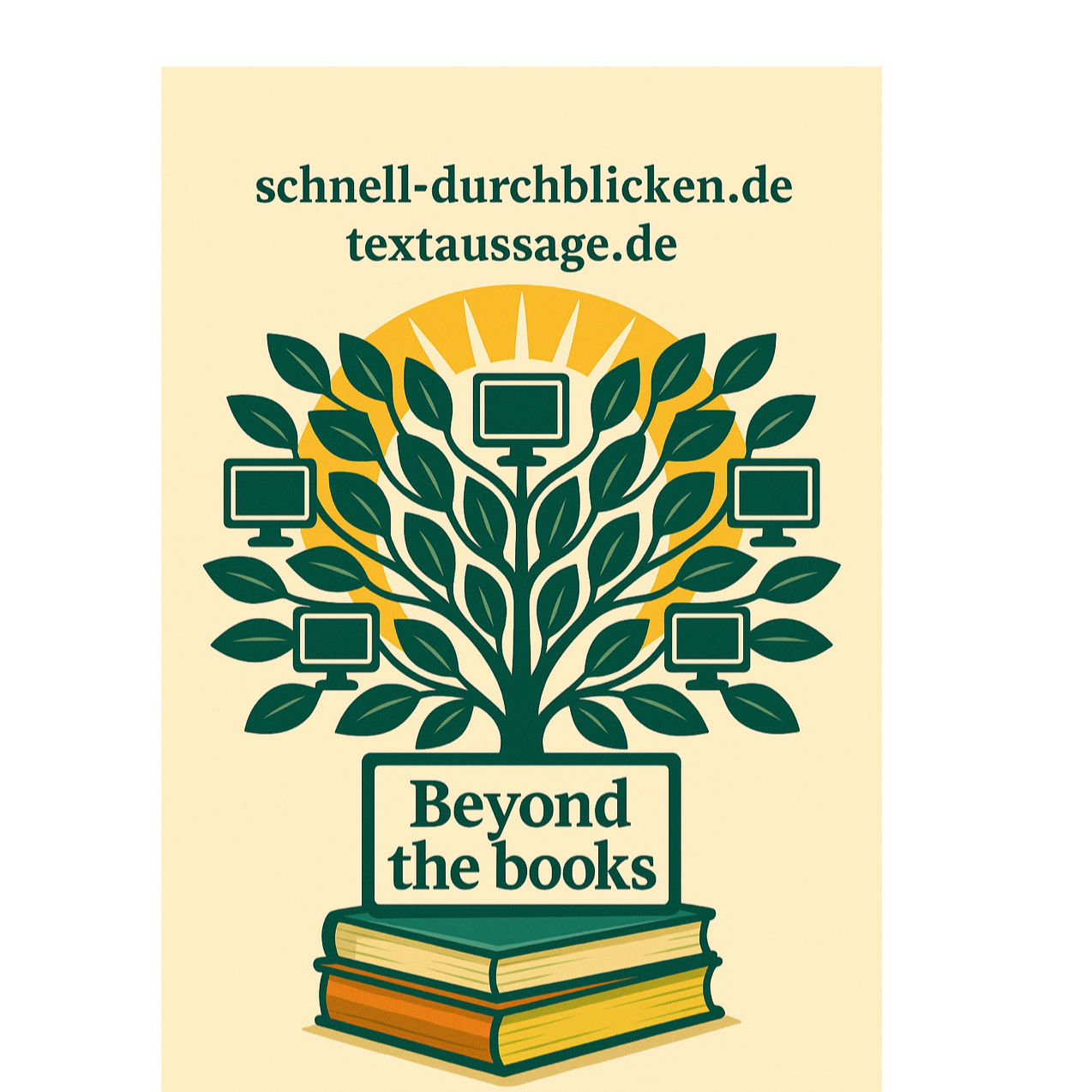Speed-Dating mit einem Gedicht: Inhalt, Aussage, Thema - Beispiel: Eichendorff, "In Danzig"
Nov 2, 2025
Wir zeigen hier, wie man schnell verstehen kann, worum es in einem Gedicht geht, was es zeigt oder deutlich macht - und wie man den Inhalt der Strophen beschreiben kann.
---
Die Dokumentation haben wir hier abgelegt:
https://textaussage.de/profi-freistein-speed-dating-mit-einem-gedicht-eichendorff-in-danzig-schnell-verstehen
---
0:01 Was ist das Speed-Dating-Training?
0:27 Ziel: Gedichte schnell verstehen – Inhalt, Aussage, Thema
0:53 Das Prüfungsbild: Schüler allein – aber Freistein im Kopf
1:08 Zwei Möglichkeiten: selbst ausprobieren oder mitgehen
1:55 Vorbereitung: Gedicht lesen und erste Notizen machen
2:29 Einstieg in Eichendorffs „In Danzig“ – Stadt im Abendnebel
2:49 1. Strophe: gespenstische Wahrnehmung der Stadt
2:52 2. Strophe: der „träumerische Mond“ – Märchenwelt aus Stein
3:33 3. Strophe: Meeresrauschen und wunderbare Einsamkeit
3:53 4. Strophe: Lied des Türmers und Gebet für die Schiffer
5:51 Gesamtaussage: zwischen Zauber, Einsamkeit und Schutzbitte
6:53 So entsteht die Inhaltsbeschreibung Strophe für Strophe
9:02 Aussage und Intentionalität – was das Gedicht deutlich macht
9:48 Zentrale Frage: Wie wirkt die Stadt und wozu regt sie an?
10:17 Dokumentation, Kanal-Hinweis und Abschluss
Show More Show Less View Video Transcript
0:01
Ja, wir wollen heute mit etwas Neuem
0:03
anfangen und zwar, dass wir eine Art
0:06
Training machen, was die Analyse von
0:09
Gedichten angeht und zwar wie beim
0:12
Speeddating geht es darum möglichst
0:14
schnell zu erkennen, was den Inhalt
0:17
angeht, was wird gesagt, dann was zeigt
0:20
das Gedicht, also die Aussagen und wie
0:23
kann man das Thema dann formulieren und
0:27
wir haben dafür folgendes Bild
0:29
erstellen. lassen. Wir stellen uns also
0:31
vor, dass wir Leute in die Situation
0:34
bringen wollen, dass sie in einer
0:36
Prüfung sitzen. Da sind sie ganz alleine
0:39
hier natürlich, aber sie haben eben
0:43
unseren Profi Freinste Freistein, wenn
0:46
das jetzt hier auch funktionieren würde
0:48
im Kopf
0:50
und so viel gelernt, geübt, dass sie
0:53
eben auch Gedichte wirklich schnell
0:56
erkennen, durchschauen und eigentlich
0:58
sollte es hier heißen verstehen. Das hat
1:01
haben wir hier wohl nicht abändern
1:03
können, aber darum geht es eigentlich
1:05
eben etwas zu verstehen. Ja, jetzt gibt
1:08
es zwei Möglichkeiten. Die erste
1:10
Möglichkeit ist die, dass man hier sich
1:13
dieses leere Blatt vornimmt und dann mal
1:17
selbst versucht herauszubekommen,
1:20
äh worum geht es im Bereich des Inhalts.
1:24
Das heißt, äh das sind die Äußerungen
1:28
des lyrischen Ichs und dann geht es am
1:33
Ende um die Frage, welche Aussagen
1:36
ergeben sich da, was zeigt das Gedicht
1:39
und am Ende kann man dann auch das Thema
1:42
präzise formulieren. Ähm was für eine
1:45
Frage steckt hier eigentlich hinter dem
1:47
Gedicht, worauf dann das Gedicht eine
1:50
Antwort gibt. Wer also das mal selbst
1:53
ausprobieren will, ne, der äh holt sich
1:55
dieses Gedicht und probiert das selbst
1:58
mal. Äh drückt hier also auf die
2:00
Pausentaste und wir kommen dann gleich
2:03
wieder. Ja, das Gedicht sollte man auf
2:06
jeden Fall gelesen äh haben, sonst
2:08
stellen wir es hier kurz vor. Äh diese
2:11
ganzen Dinge, die wir hier rechts
2:12
notiert haben, werden wir gleich
2:14
natürlich hier äh präsentieren. Das muss
2:17
man nicht alles sich erstmal
2:19
aufschreiben, das kann man auch anders
2:21
machen. Aber wichtig ist, man muss das
2:23
eigentlich vorher gemacht haben, bevor
2:25
man dann den Inhalt beschreiben kann.
2:29
Und zwar schauen wir uns das mal an. Das
2:30
Ganze geht also hier um danzig. Es geht
2:34
also um eine Stadt. Wichtig ist, es ist
2:37
ein Abend Situation. Nebel spielt eine
2:41
Rolle und das ganze gibt einen gewissen
2:44
Gespenstereindruck,
2:46
dann hat man das eigentlich schon. Dann
2:49
in der zweiten Strophe. Träumerisch der
2:52
Mond drauf scheinet, wird der Mond
2:54
natürlich hier personalisiert und zwar
2:57
positiv, ne? Da träumerisch ist jemand,
2:59
der gar nicht mehr nur nachdenken
3:01
willen, Gefühle hochkommen und die
3:03
Gefühle gehen angeblich beim Mond dann
3:05
auch in die Richtung, dass die Stadt ihm
3:08
hier gefällt oder das, was er sieht. Und
3:11
jetzt heißt es ähm hier als l und das
3:16
heißt natürlich ein Vergleich gemacht,
3:18
das ist nicht, aber es sieht so aus, als
3:20
wäre es, dass hier ein Zauber wirkt in
3:23
einer Märchenwelt entsteht und die ist
3:26
vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet,
3:28
dass sie versteint ist, zu Stein
3:31
geworden ist.
3:33
Dann in der dritten Strophe ist ganz
3:36
wichtig dieses ferne Meeresrauschen.
3:39
Danzig ist ja eine Stadt, die am Meer
3:41
liegt und die Konsequenz daraus ist
3:44
eigentlich, dass äh das lyrische Ich
3:47
sich einsam fühlt, aber das wunderbar
3:51
findet. Und die letzte Strophe schließt
3:53
das Ganze dann ab. Das lyrische Ich ähm
3:57
hört jetzt ähm plötzlich ein uraltes
4:00
Lied und uralt heißt natürlich hier in
4:03
der Zeit der Romantik immer auch
4:05
vertraut, das kennt man, das löst
4:08
positive Gefühle aus und der Türmer
4:11
wacht ja auch über alles. Und dann kommt
4:13
der entscheidende Punkt. Ähm wolle Gott
4:16
den Schiff Schiffer bewahren, da sind ja
4:19
Schiffe unterwegs. Das war damals
4:21
gefährlicher als heute unter Segeln. Man
4:23
hatte keinen Motor dabei. Die
4:25
Rettungsboote waren nicht besonders gut
4:27
und darum sollte Gott die Schiffer
4:29
bewahren. Da betet das lyrische Ich äh
4:32
für, der bei Nacht vorüberzieht. Nacht
4:35
ist natürlich auch eine Situation der
4:37
Gefahr. Hier ist das eine Märchenwelt.
4:40
Auf dem Wasser kann das sehr gefährlich
4:42
sein und früher sind die Leute ja auch
4:44
meistens dann äh abends an Land
4:46
gegangen, wenn das ging und am nächsten
4:48
Tag erst weitergefahren. Was dann die
4:51
Aussage angeht, kann man das ja einfach
4:53
fortsetzen. Gedicht zeigt äh eben eine
4:56
gespenstisch wirkende Nacht im Nebel,
4:59
aber sie ist auch verzaubert schön, das
5:02
wird dem Mond zugeschrieben und ergibt
5:05
insgesamt eine wunderbare Einsamkeit.
5:09
Und am Ende steht typisch für
5:11
Eichendorf, der ja sehr religiös war,
5:13
ein Schutzgebet für andere wendet sich
5:15
dann an Gott und das macht die ganze
5:17
Sache endgültig rund. Hier ist also
5:20
Schutzgewehrt
5:22
und er will das nur noch eben auch für
5:24
andere dann weitergeben. Was das Thema
5:26
angeht, das ist ja immer die Frage, die
5:28
dahinter steckt. Wie wird die Stadt
5:31
gesehen und was bewirkt dieses sehen? Es
5:35
bewirkt z.B., dass man sich in einer
5:38
wunderbaren Einsamkeit befindet und auch
5:41
möchte, dass es anderen so gut geht wie
5:43
einem selbst. Soweit. Also unsere
5:45
Notizen. Wir zeigen gleich, wie wir das
5:48
in eine Strophenbeschreibung
5:49
zusammengefasst haben.
5:53
Ja, wir haben jetzt hier links noch mal
5:56
die Sachen da klein reingesetzt. Das
5:59
haben wir nicht so optimal vorbereitet.
6:00
Das mussten wir eben mit der Hand noch
6:02
mal nachmachen, aber so können wir
6:03
wenigstens auf einzelne Dinge
6:05
zurückgreifen. Und wir zeigen jetzt
6:07
einfach, wie wir das ähm inhaltlich
6:10
zusammengefasst haben. Das Besondere ist
6:14
eigentlich äh, dass wir zunächst mal den
6:16
die Einleitung da formulieren. Es geht
6:20
um. bisschen kleiner machen. Das ist
6:22
hier jetzt zu groß geraten. So um das
6:26
Gedicht dann sich Titel Josef von
6:28
Eichendorf alles in Ordnung. Thema ähm
6:32
wie wird die Stadt am Abend
6:34
wahrgenommen? Äh so haben wir es hier äh
6:38
formuliert. Das kann man auch anders
6:39
machen, aber das haben wir ja eben schon
6:41
ungefähr festgelche Wirkung hat es auch
6:43
und das wäre so eine Zusammenfassung.
6:45
Jetzt in der ersten Strophe beschreibt
6:48
das lyrische Ich. Wir schlagen vor bei
6:50
Gedichten die inhaltliche
6:52
Zusammenfassung immer vom lyrischen Ich
6:54
ausgehen zu lassen. Es gibt ja nicht wie
6:56
in einer Kursgeschichte äh normale
6:58
Handlung oder so etwas. Das macht die
7:00
Sache deutlich einfacher. Sollte man mit
7:02
der Lehrkraft auch besprechen, ob die
7:03
damit einverstanden äh ist oder bessere
7:06
Lösungen vielleicht hat. Äh beschreibt
7:08
das lyrische Ich die Stadt, wie sie ihm
7:10
im Abendnebel vorkommt. Das ist
7:12
entscheidend. Es geht um Wahrnehmung.
7:14
Die Statuen vor den Türen kommen ihm
7:17
dabei wie Gespenster äh vor. Da haben
7:20
wir das noch mal wiederholt, das
7:21
Vorkommen, aber das macht jetzt hier an
7:22
der Stelle nichts. Äh das ist der
7:24
entscheidende Punkt. Dann in der zweiten
7:26
Strophe wendet das lyrische Ich sich
7:29
dann dem Mond zu. Wende das lyrische Ich
7:33
sich, muss es natürlich heißen, Dämon
7:35
zu. Der träumerisch, das haben wir
7:38
übernommen, weil man das gar nicht
7:40
anders formulieren kann, ne? Träumerisch
7:42
äh ist eben eine Sache, wo man so etwas
7:45
Bewusstsein so nicht mehr so ganz hat.
7:47
Ins Träumen gerät, darum haben wir hier
7:49
auch mal ausnahmsweise zitiert.
7:52
Träumerisch auf die Stadt blickt das
7:53
Lisch. Ich hat den Eindruck, das ist
7:56
wichtig, dass die Stadt dem Mond
7:58
gefällt. Das sollte man also sichtbar
8:00
machen. Das ist keine Realität, sondern
8:03
das lyrische Ich drückt das so aus.
8:05
Verglichen wird das mit einer
8:06
Märchenwelt, die durch einen Zauber zu
8:08
Stein geworden ist. Man sieht also, wie
8:11
wichtig das lyrische Ich hier ist, weil
8:14
alles ja durch seine Perspektive
8:15
eigentlich durchgeht. Darüber hinaus
8:17
gibt es ja in der Regel nichts bei einem
8:20
Gedicht. In der dritten Strophe wendet
8:22
das lyrische Ich sich dann der weiteren
8:25
Umgebung zu, glaubt glaubt das Rauschen
8:28
des Fernes zu hören und sieht sich in
8:31
eine Einsamkeit. Ja, man sieht das immer
8:33
wieder diese Formulierungen, die
8:35
deutlich machen, das sind Dinge, die im
8:37
lyrischen Ich passieren, die es so fühlt
8:40
oder ähnliches mehr. Und die Einsamkeit
8:42
kommt ihm wie ein Wunder vor. In der
8:45
vierten Strophe wendet sich das Lyrische
8:47
schon wieder dann dem Türmer zu, aber da
8:49
ändern sich eben die Perspektiven, der
8:51
wie früher ein sehr altes Lied singt,
8:53
also Vertrautheit. Das Gedicht schließt
8:55
mit einer gebetartigen Bitte an Gott,
8:58
dass dieser den vorbeifahrenden Schiffer
9:00
doch bitte bewahren soll.
9:02
So, wenden wir uns jetzt der Aussage zu,
9:05
was man auch Intentionalitäte nennt. Das
9:08
heißt eigentlich, in welche Richtung
9:09
läuft das Ganze, das spannt sich so auf
9:12
und immer klarer und größer wird dann
9:15
das, was das Gedicht zeigt oder deutlich
9:17
macht. Einmal die Stadt danzig in einer
9:19
nebligen Situation am Abend, wobei
9:21
gespenstische Eindrücke entstehen. Dem
9:24
Mond wird zugeschrieben, dass ihm die
9:27
Stadt gefällt und er die Stadt
9:28
betrachtet, wie von einem Zauber zu
9:31
Stein geworden. Ein altes Lied des
9:34
Türmers und der Gedanke muss es
9:38
natürlich heißen hier an das Meer führt
9:41
am Ende zu einer Art Schutzgebet für die
9:44
Seeleute wegen der Gefahren, die mit dem
9:46
Meer verbunden sind. Jetzt hat man die
9:48
Antworten, die das Gedicht gibt. Ab
9:50
welche Frage liegt dem zu Grunde? Passen
9:53
zu den Aussagen. Das Gedicht beschäftigt
9:56
sich mit der Frage, wie einem an einem
9:58
nebligen Abend die Stadt danzig
10:00
vorkommen kann und wozu es einen anregen
10:03
kann. Man sieht, dass das hier natürlich
10:06
ein bisschen präziser ist als das, was
10:09
wir da oben formuliert ähm haben. Von
10:13
daher also hier auch noch ein kleiner
10:14
Fortschritt, eine Präzisierung.
10:17
Und wie immer legen wir die
10:19
Dokumentation dann hier auf dieser Seite
10:21
ab, packen die URL auch hier zu den
10:24
Infos im Video und bringen hier oben
10:25
noch einen Button unter und wir freuen
10:28
uns natürlich über Fragen und Anregungen
10:31
und auch natürlich, wenn ein bisschen
10:34
auf unserem Kanal aufmerksam gemacht
10:35
wird, weil ja viele Leute das Problem
10:37
haben, wie kann ich eine
10:38
Inhaltsbeschreibung zu einem Gedicht in
10:41
Strophen machen? Wir wünschen auf jeden
10:43
Fall viel Erfolg. M.
#Literary Classics
#Poetry