Worum es hier geht:
Präsentiert wird hier ein Gedicht, das auf beeindruckende Weise die Arbeit für das eigene Land verbindet mit Rücksichtnahme auf andere Länder und Völker.
Zu finden ist das Gedicht z.B. hier.
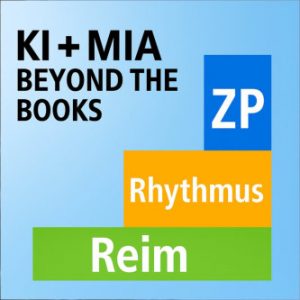 Bitte auf den möglichen Zusatzpunkt am Ende achten.
Bitte auf den möglichen Zusatzpunkt am Ende achten.
Bertolt Brecht,
Kinderhymne
- Die Überschrift lässt ein feierliches Gedicht erwarten, das bei festlichen Anlässen, bsd. auch im politischen Bereich gesungen wird.
- In einer Gedichtsammlung wird dieses Gedicht den sogenannten „Kinderliedern“ zugeordnet, für die das Jahre 1956 genannt wird, also eine Zeit, in der die beiden deutschen Staaten nach dem II. Weltkrieg schon 7 Jahre existieren und in Brechts neuer Heimat, der DDR, versucht wird, einen sozialistischen Staat aufzubauen, der als „Arbeiter- und Bauernstaat“ in vielem mit der deutschen Vergangenheit brechen will.
- Die erste Strophe präsentiert dann eine mehrfache Aufforderung, ganz bestimmte Eigenschaften bzw. Tätigkeiten zu zeigen:
- Dabei wird „Anmut“ mit „Mühe“ verbunden, was nicht einfach ist. Tänzer auf der Bühne können das möglicherweise.
- Ähnliches gilt für Leidenschaft und Verstand, was sich fast gegenseitig ausschließt.
- Das Ziel ist das Blühen eines guten Deutschlands – also eines Landes, das nicht von den Nachbarn gefürchtet wird.
- Dazu passt auch die Einordnung der Qualität in eine Art Normalbereich.
- Was wir schon angenommen haben, wird zu Beginn der 2. Strophe bestätigt. Die mögliche Angst anderer Völker wird sogar mit der Vorstellung von einer Räuberin verbunden.
- Dem entgegengesetzt wird eine Beziehung, die dem Reichen der Hände entspricht – also friedlich, vertrauensvoll, verbindlich.
- Die dritte Strophe betont dann noch mal, dass die Deutschen sich einem allgemeinen Level der Völker anpassen sollen.
- Die regionale Begrenzung ist wohl eine Anspielung auf das sogenannte Deutschlandlied, wo die Grenzen deutlich weiter gezogen werden.
„von der Maas bis an die Memel / von der Etsch bis an den Belt –„
https://www.volksliederarchiv.de/deutschland-deutschland-ueber-alles/ - Auf jeden Fall wird den Deutschen hier Bescheidenheit empfohlen.
- In der letzten Strophe wird dann die Verbesserung des Landes als Voraussetzung für Liebe und Schutz genannt.
- Am Ende noch mal der klare Hinweis, dass man nichts mehr schätzen soll, als es andere Völker auch tun.
 Möglicher Zusatzpunkt:
Möglicher Zusatzpunkt:
Bedingt durch die besondere Geschichte Deutschlands, bsd. im Hinblick auf die Verbrechen im der NS-Zeit war so etwas wie Nationalgefühl in Deutschland nach 1945/1949 ziemlich verpönt.
Daraus kann man die Frage ableiten:
Bedeutet das Gedicht nicht, dass wir Deutschen – und alle, die dazugehören wollen – dies Land genauso lieben dürfen und vielleicht sogar sollen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, bei denen das für ihr Herkunftsland viel selbstverständlicher ist.
Dann kann man die Frage diskutieren – gerade mit Leuten mit einem anderen biografischen Hintergrund: Was bedeutet es, sein Land zu lieben. Und wo sollten wir weiter mit gutem Beispiel vorangehen – wie Brecht es fordert.
Zusammenfassung:
- Insgesamt ein Gedicht, das die junge Generation fernhalten will von den Zeiten und den Vorstellungen, als die Deutschen noch glaubten. „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“
- Das ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte des 20. Jhdts. sicher ein richtiger Ansatz.
- Allerdings kann man sicher die Frage diskutieren, ob das alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes so sehen – zumal viele aus anderen Kulturen kommen und durch die deutsche Geschichte in keiner Weise belastet sind.
Äußere Form, Reim, Rhythmus und sprachliche Mittel
- Reim ist einfach: Kreuzreim
- Rhythmus = etwas schwieriger – es geht um die betonten Silben, erst die mehrsilbigen Wörter, dann schauen, ob man die einsilbigen so betonten kann, dass sich ein regelmäßiger Wechselrhythmus ergibt.
Anmut sparet nicht noch Mühe
X x X x X x X x
betonte, unbetonte Silbe im regelmäßigen Wechsel
Trochäus
Dann schauen, ob man den Rest des Gedichtes auch in diesem Rhythmus vorlesen kann.
Sprachliche Mittel:
-
Parallelismus
(Z. 1–2): „Anmut sparet nicht noch Mühe / Leidenschaft nicht noch Verstand“ – betont die Vielfalt an Tugenden, die nötig sind. -
Vergleich
(Z. 4): „wie ein andres gutes Land“ – stellt Deutschland nicht über andere. -
Personifikation
(Z. 6): „Räuberin“ – starke Personifikation Deutschlands in seiner negativen Vergangenheit. -
Einfachheit der Sprache – betont die Klarheit und Allgemeingültigkeit der Botschaft, die sich ja von der Tonlage an Kinder richten soll.
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Man kann dieses Lied natürlich gut vergleichen mit dem umstrittenen Lied:
„Deutschland, Deutschland über alles“
Näheres dazu auf der folgenden Seite: - Infos, Tipps und Materialien zu politischen Gedichten
https://textaussage.de/themenseite-politische-lyrik - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos