Worum es hier geht:
Wir gehen davon aus, dass die Geschichte als Text vorliegt und geben Tipps zu verschiedenen Aspekten.
Da uns der Text der Geschichte nicht mehr vorliegt, wäre es schön, wenn jemand uns im Kommentar einen entsprechenden Hinweis gibt.
https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht
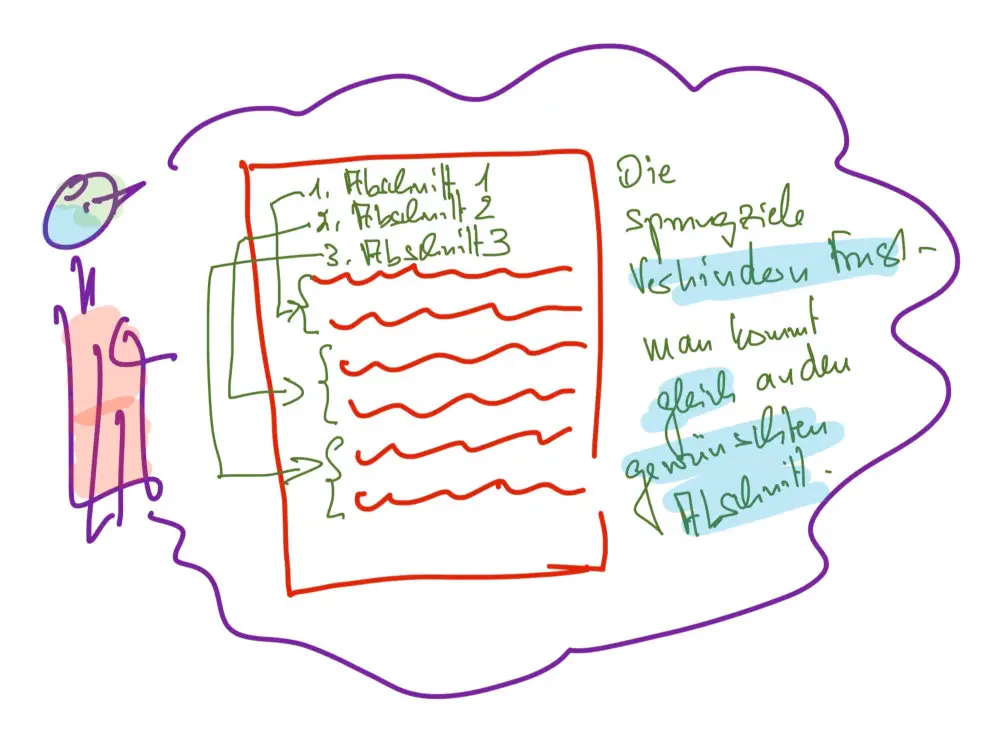
Zunächst ein Überblick über den Inhalt
Die Handlung lässt sich in drei Hauptabschnitte gliedern: Klas‘ soziale Situation, die filmische Begegnung mit dem Vater und der rätselhafte Schluss, der in einem Gewaltakt mündet.
- Die problematische Ausgangslage (Soziales Außenseitertum)
- Klas als uneheliches Kind: Die Geschichte beginnt damit, dass der Schüler Klas mit seiner Herkunft konfrontiert wird. In der Zeit, in der die Geschichte spielt, spielte es noch eine große und negative Rolle, ein uneheliches Kind zu sein, was oft zu Diskriminierung führte.
— - Der fehlende Vater: Klas wird von einem Lehrer immer wieder nach seinem Vater gefragt, obwohl alle wissen, dass Klas keinen Vater nennen kann, da dieser keine Rolle in seinem Leben spielt.
— - Armut und Vernachlässigung: Klas wächst unnötigerweise in armen Verhältnissen auf.
— - Emotionale und materielle Schuld: Die Geschichte thematisiert die Schuld des Vaters nicht primär wegen der Zeugung, sondern wegen der Vernachlässigung seiner Pflichten und der Tatsache, dass Klas in Armut aufwachsen muss.
- Die filmische und existenzielle Konfrontation (Der Wendepunkt)
- Die Begegnung im Kino: Der zweite Teil der Geschichte handelt von der Begegnung Klas‘ mit seinem Vater. Diese Begegnung findet jedoch nicht persönlich, sondern über die Leinwand in einem Kino statt.
- Die bittere Erkenntnis: In diesem Moment erfährt Klas die bittere Erkenntnis, dass sein Vater krank ist.
- Die Angst vor dem Erbe: Basierend auf dieser Erkenntnis glaubt Klas zu wissen, dass er von seinem Vater zwar keine Güter, aber stattdessen „unerwünschtes schicksalsschlägiges Erbe“ (gemeint ist die Krankheit) erben würde.
- Der Wutausbruch: Aufgrund dieser Gewissheit, nichts Materielles, sondern nur eine schicksalhafte Krankheit zu erben, steigt Wut in Klas auf, dem „Nichts besitzenden“.
- Der rätselhafte und gewaltsame Schluss
- Der Entschluss zur Tat: Klas stürmt aus dem Kino (dem Ort, wo er die Wahrheit über das Erbe erfuhr) und rennt durch Regen und Dreck zu einem feinen Haus. Sein Ziel ist es, den „fremden, ihm doch nahen Mann zu töten“. Das „feine Haus“ steht im Gegensatz zum „Dreck“.
- Die Konfrontation und der Schuss: Der Vater bekennt sich offenbar zu seiner Verantwortung. Die Schlussszene ist jedoch extrem unklar erzählt.
◦ Der Vater geht zu einer Tür und schließt sie (es ist unklar, ob von innen oder außen).
◦ Plötzlich liegt ein Revolver auf dem Tisch (es wird als „zufällig vergessen“ beschrieben).
◦ Im selben Augenblick wird geschossen.
- Die Offenheit der Deutung:
- Es ist unklar, wer die Waffe benutzt hat und ob der Vater (aus Schuld oder wegen seiner Krankheit) oder der Sohn (aus Angst vor dem Erbe und Frustration) stirbt. Der Wendepunkt (die Entdeckung der Krankheit) ist sehr ausgeprägt, aber die Auflösung durch den Schuss ist „nicht sehr schön auserzählt“ und hängt „in der Luft“, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um ein Fragment handelt, das Koeppen selbst nicht fertig durchgearbeitet hat.
Thema:
- Thema der Geschichte [erst nach der Lektüre einfügen, wenn man die Geschichte verstanden hat!!!]
Vorschlag:
Die Geschichte thematisiert die traumatische und distanzierte Beziehung zwischen dem Protagonisten Klas und seinem abwesenden, wohlhabenden Vater, sowie Klas‘ Kampf mit seiner Identität als uneheliches Kind, das in Armut aufwächst.
Direkter Einstieg – typisch für eine Kurzgeschichte
- Direkter Einstieg: grundsätzlich gegeben, wenn auch nicht besonders hervorgehoben
Frage: Wer sagt das „überflüssig“, gibt also einen Kommentar ab, der Erzähler? Wir glauben eher, dass das Denken der Figur, also von Klas wiedergegeben wird.
—
Der erste Teil der Geschichte
- Im ersten Teil wird ausgehend von dem problematischen Verhalten eines Lehrers die Schwierigkeit des Schülers dargestellt, der immer wieder nach seinem Vater gefragt wird, obwohl der in seinem Leben keine Rolle spielt und alle eigentlich wissen, dass er als uneheliches Kind keinen Vater nennen kann.
- Hierzu muss man wissen, dass die Geschichte aus einer Zeit stammt, wo das noch eine große Rolle spielte – und zwar im negativen Sinne. Junge Frauen, die unverheiratet ein Kind zur Welt brachten, wurden zum Teil aus der Gemeinschaft ausgestoßen, zumindest diskriminiert. Das wirkte sich dann wie in dieser Geschichte manchmal auch mehr oder weniger auf das Kind aus.
Der 2. Teil der Geschichte
- Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Begegnung mit dem Vater, zunächst nur über die Leinwand in einem Kino, aber mit der bitteren Erkenntnis, dass dieser Vater eine Krankheit hat, von der der Sohn glaubt, er würde sie an ihn vererben.
- Hier ist es etwas seltsam, dass in der Geschichte keine näheren Angaben dazu gemacht werden. Vor allem werden die Ängste des Sohnes nicht wirklich sichtbar, so dass der extreme Schluss ein bisschen in der Luft hängt.
Der Schluss der Geschichte
- Der Schluss der Geschichte ist wirklich ein Problem. Der Vater bekennt sich anscheinend zu seiner Verantwortung, die natürlich in Wirklichkeit in der Form gar nicht gegeben ist. Denn sonst müssten ja alle Eltern für Erbkrankheiten, die sie vielleicht gar nicht kennen, die Verantwortung im Hinblick auf die nächste Generation übernehmen. Viel näher läge eine Verantwortung für das Sich-nicht-Kümmern um das Kind, das unnötigerweise in armen Verhältnissen aufwächst
- Dann geht der Vater zu einer Tür und schließt sie – von außen wohl oder von innen?
- Dann liegt da plötzlich auf dem Tisch (auf welchem?) ein Revolver, aus dem geschossen wird – was heißt das: Wer hört das?
Je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr hat man den Eindruck, dass das einfach schlecht erzählt ist. Die Geschichte wäre wohl bei einem Nachwuchs-Schreibwettbewerb mit diesem Schluss nicht durchgegangen.
Versuch eines Verständnisses
- So dürfen wir uns also jetzt als Leser damit rumärgern. Andererseits: Je lückenhafter und unklarer der Autor arbeitet, umso mehr dürfen wir als Leser die Initiative ergreifen:
- Wir verstehen das also so: Der Vater übernimmt die Schuld, geht ins Nachbarzimmer, dort sieht der Sohn einen Revolver liegen – ganz schön scharfsichtig auf die Entfernung.
- Dann wird es noch härter: Im selben Augenblick wird geschossen – muss der Vater die Waffe nicht in die Hand nehmen, was etwas dauert?
- Nun versuchen wir eine andere Lösung: Der Vater geht zur Tür, schließt sie von innen, damit die Dienerschaft nicht zu viel mitbekommt, kehrt zum Tisch zurück – wo der Revolver rein zufällig schon liegt. Hat der Sohn ihn nicht vorher schon gesehen? Und nichts gesagt?
- Nun ja, vielleicht erschießt sich ja auch der Sohn, aber das erscheint uns doch ein arger Bruch der Perspektive. Dann sollte man den Schuss schon im Aktiv schreiben und nichts ins Passiv ausweichen, also zum Beispiel: „Auf dem Tisch lag aber, wie zufällig vergessen, ein Revolver. Klas nahm das Angebot an.“
- Eine weitere Möglichkeit stellt der Erzähler dar: Der Vater geht raus, der Sohn bleibt zurück. Und der Erzähler teilt uns mit, dass da rein zufällig ein Revolver liegt und der Vater sich erschießt – und der Erzähler tut so, als wisse er das gar nicht – sehr seltsam.
Ein Stoßseufzer zwischendurch
- Ach, Wolfgang Koeppen bzw. ihr lieben Nachlassverwalter, denn die haben uns die Geschichte überliefert. Sagt uns doch einfach, dass das hier ein etwas schräg geratenes Fragment ist, das nicht zu Ende durchgearbeitet worden ist.
- Wahrscheinlich hat der Autor sich da mal einen Zettel genommen und es einmal runtergeschrieben – auf mögliche Brüche und Probleme hat er nicht weiter geachtet, denn er wusste ja, wie diese Geschichte fiktiv abgelaufen ist.
- Aber für uns war das wenigstens eine Interpretationsübung – und da wir die Geschichte nicht unter dem Druck einer Klassenarbeit interpretieren mussten, haben wir zumindest ein bisschen Dampf ablassen können.
Kurzgeschichten-Eigenschaft
- Was den Kurzgeschichten-Charakter angeht, gibt es zwar einen direkten Einstieg, der sich aber dann zu einer Art Einleitung auswächst. Das hätte man sehr viel direkter erzählen können:
- Versuchen wir mal, Koeppen zu verbessern:
„Schon kurz nach Stundenbeginn passierte es wieder. Der Lehrer kam irgendwie auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen – und schon musste er sich wieder gegen eine dieser unnötigen Fragen wappnen: ‚Ach, Klas, sag mal: Wie ist es deinem Vater eigentlich im Krieg gegangen?“ So ging das ständig – wenn immer sich eine Gelegenheit bot. Dabei wussten sein Lehrer und wohl ziemlich alle in der Klasse, dass er eben ein uneheliches Kind war und damit eigentlich nicht so richtig auf der Welt.“
usw. - Die Handlung erstreckt sich wegen dieser seltsamen Einleitung über einen längeren Zeitraum. Richtig konzentriert wird es erst im zweiten Teil, wenn es um diesen Abend geht.
Frage des Wendepunktes
Der Wendepunkt ist natürlich sehr ausgeprägt, wenn auch nicht sehr schön auserzählt, wie wir oben schon festgestellt haben.
Da der Schluss ziemlich unklar ist, ist auch die Frage der Offenheit nicht eindeutig zu klären: Hat der Vater sich erschossen, vielleicht mehr wegen seiner Krankheit als wegen des Sohnes, ist die leidige Angelegenheit eigentlich erledigt. Die Frage bleibt aber, wie der Sohn mit diesem Erbe weiter umgeht.
Hat der Sohn sich erschossen – aus Angst vor der Krankheit – hat er das Problem für sich gelöst – und es ist die Frage, wie der Vater mit seiner Einsicht umgeht.
Bestimmung des Themas
- Versuchen wir abschließend, das Thema zu bestimmen, das wir dann oben eintragen könnten – dort wird es ja meistens im Rahmen der Einleitung präsentiert:
In der Geschichte geht es um die Frage der Schuld durch Vernachlässigung der Pflichten durch einen Vater, der seinen Sohn unehelich aufwachsen lässt.
Vorschlag für den Einsatz der Geschichte im Unterricht
- Dann abschließend noch ein Vorschlag für den Einsatz im Unterricht:
- Warum wird den Schülern nicht offen gesagt, dass dieser Text aus dem Nachlass stammt, der Autor ihn also nicht veröffentlicht hat, vielleicht in der Form auch gar nicht wollte.
- Eine wunderbare Situation: Endlich können Schüler mal Halbfertiges checken und ggf. verbessern. Denn natürlich gibt es einige Stellen im Text, die gut erzählt sind, aber vor allem die Angst vor der Erbkrankheit und die Story im Haus des Vaters sind einfach schlecht erzählt.
- Und wenn man dann noch den Schülern sagt, dass Koeppen unter einer besonderen Schreibblockade litt, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass dieser Text möglicherweise zeigt, dass Koeppen nach seinen großen Romanen irgendwann seine Texte nicht mehr fertig bekommen hat, sondern es eben halbfertige Fragmente geblieben sind.
Das Thema „Schreibblockade“ bei Koeppen
Zur Schreibblockade Koeppens findet man zum Beispiel hier Informationen:
https://www.nzz.ch/feuilleton/wolfgang-koeppen-litt-unter-seiner-schreibblockade-ld.1481609
Wer noch mehr möchte …
- Fragen und Anregungen können auf dieser Seite abgelegt werden:
https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht - Ein Verzeichnis aller unserer Themenseiten findet sich hier:
https://textaussage.de/themenseiten-liste - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier:
https://textaussage.de/stichwortverzeichnis - Unser Videokanal auf Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSsVID93txXLyKfO5UuL6Og