Ein etwas schwieriges Gedicht – aber mit viel Harmonie
- Das Gedicht „See in der Großstadt“ wird zur Zeit anscheinend überall im Deutschunterricht behandelt.
- Und es lohnt sich – auch wenn es nicht ganz einfach zu verstehen ist.

Kurzer Überblick über unsere verschiedenen Seiten zu diesem Gedicht
- Wer das Gedicht selbst „knacken“, also optimal verstehen möchte, der sollte zunächst auf diese Seite zugreifen. Dort bekommt er nämlich nur Tipps – und kann dann selbst „Verständnis trainieren“:
https://schnell-durchblicken.de/mia-fixpunkte-tipps-zum-gedicht-see-in-der-grossstadt-von-oliver-tietze
— - Anschließend kann man die eigene Lösung vergleichen mit unserer:
https://schnell-durchblicken.de/mia-fixpunkte-loesungen-zum-gedicht-see-in-der-grossstadt-von-oliver-tietze
— - Wem das alles zu viel Harmonie in der Natur ist, dem gefällt vielleicht das folgende Kontrastgedicht:
mit Video-Erklärung:
https://schnell-durchblicken.de/varianten-von-aeusserungen-des-lyrischen-ichs-gezeigt-am-gedicht-flucht-aus-dem-wald
—  Weiter unten geben wir einen Tipp, wie man Zusatzpunkte erreichen kann durch eine intelligente Frage zum Text, die diskutiert werden kann.
Weiter unten geben wir einen Tipp, wie man Zusatzpunkte erreichen kann durch eine intelligente Frage zum Text, die diskutiert werden kann.
Schneller Überblick – und vielleicht ein bisschen Motivation 🙂
Auf das Bild gehen wir auf einer eigenen Seite ein. Hier soll es nur ein bisschen gute Stimmung machen und die eigene Fantasie anregen – dann macht es mehr Spaß, sich genauer mit dem Gedicht zu beschäftigen.
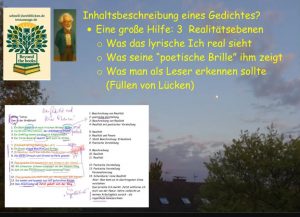
Wer sich den Inhalt des Gedichtes gerne im Video erklären lassen will,
der kann es sich hier anschauen:
https://youtu.be/27f1wq_nr1o
Nun also unser erste Einstieg in das Gedicht:
Es geht ja erst mal darum, mit so einem Text Kontakt aufzunehmen.
Gefunden haben wir das ganze Gedicht zum Beispiel hier.
Hier nur die erste Strophe, um zu zeigen, was das Besondere dieses Gedichtes ist.
- Ein Blatt tanzt froh nach frischen Windes Willen
- Das Lyrische Ich, also der Sprecher oder die Sprecherin (ab jetzt immer LI abgekürzt), beschreibt, wie er ein Blatt sieht, das sich anscheinend vom Baum gelöst hat und nun im Wind tanzt.
- Da der aber keinen Willen haben kann, haben wir hier schon mal eine Personifizierung.
- Herab vom Ahornstamm, der schilfwärts strebt.
- Aha, jetzt erfahren wir, wo das Blatt herkommt
- und natürlich scheint hier die ganze Natur „personifiziert“ zu sein, denn dieser Ahornstamm beugt sich anscheinend zum Schilf eines Sees hinunter.
- Im Sinkflug kommt ein Kranich eingeschwebt.
- Nach Blatt und Baum kommt jetzt auch noch ein Kranich an.
- Der ferne Baukran lauscht wohl auch im Stillen
- Und wir wundern uns schon nicht mehr, dass auch noch ein Baukran personifiziert wird.
- Er ist aber weit weg, was die Naturidylle nicht stört.
Weiter unten gehen wir auch auf die restlichen Zeilen ein:
Übersicht, was wir noch zu dem Gedicht haben
- mp3-Vorstellung des Gedichtes
Auf der folgenden Seite kann man sich das Gedicht per Audio-Datei vorstellen lassen. Das hat den Vorteil, dass man hört und gleichzeitig lesen und markieren kann.
https://textaussage.de/mat3009mp3
— - Grafische Darstellung mit mp3-Erklärung des Schaubildes
Wer sich den Inhalt des Gedichtes gerne mal in einem Schaubild klarmachen möchte, findet es hier mit Erklärung:
https://textaussage.de/oliver-tietze-see-in-der-grossstadt-einfach-erklaert-an-einem-schaubild
— - Mit Video: Hilfen für die Inhaltsbeschreibung – da haben wir nämlich 3 Varianten gefunden
https://schnell-durchblicken.de/inhaltsbeschreibung-von-gedichten-tipp-3-realitaetsebenen-beispiel-see-in-der-grossstadt-von-oliver-tietze
— - Äußere Form (Sonett), Reim und Rhythmus
Darauf gehen wir auf dieser Seite ein:
https://textaussage.de/oliver-tietze-see-in-der-grossstadt-aeussere-form-reim-und-rhythmus
— - KI-Interpretation als Beispiel, wie gut die Künstliche Intelligenz schon ist:
https://textaussage.de/bildinterpretation-zu-oliver-tietze-see-in-der-grossstadt-harmonie-von-natur-und-grossstadt
Wir zeigen hier, wie ChatGPT dieses Gedicht „interpretiert“ – und was der KI dazu eingefallen ist.
Aber wir kommentieren das natürlich auch durch Mia = Menschliche Intelligenz in Aktion. Die sollte bei uns immer Vorrang haben, sonst lernen wir ja nichts.
Ansonsten eine gute Gelegenheit, hinterher mal selbst zu schauen, was man noch anders oder sogar besser machen könnte.
— - Spontane Reaktion einer Schülerin auf das Gedicht
Weiter unten ist sie zu finden. Da kann man dann mal bei sich selbst überprüfen, auf wie viel man selbst auch schon gekommen wäre.
Denn im Unterricht kann man natürlich punkten, wenn man gleich schon was sagen kann. Hier hat man dann eine Art Vorlage.
— - ChatGPT-Bild mit Erklärung
und damit auch Anregungen für eigenes Weiter-Entwickeln der Darstellung
https://textaussage.de/bildinterpretation-zu-oliver-tietze-see-in-der-grossstadt-harmonie-von-natur-und-grossstadt
Nun zur Detail-Vorstellung des Gedichtes
Schon der Titel des Gedichtes deutet die Spannung zwischen zwei Welten an. Denn normalerweiserweise gibt es in einer Großstadt keinen See oder er wird zumindest nicht so wahrgenommen wie in der freien Natur.
Strophe 1
Die spielt dann in den ersten drei Zeilen der ersten Strophe die entscheidende Rolle. Die Zeilen sind geradezu mit Naturelementen überschwemmt. Da werden einem Blatt zunächst menschliche Verhaltensweisen beziehungsweise Einstellungen zugeschrieben (Personifikation), Wenn es heißt, dass es „tanzt“ und das auch noch „froh“ tut. Es folgt der Hinweis auf einen frischen Wind, der aber auch vermenschlicht wird, weil ihm ein Wille zugeschrieben wird.
In der zweiten Zeile wird aus dem Tanzen eine Abwärtsbewegung, zum einen beim Blatt vom Ahornstamm. Zum anderen wird auch dem noch ein Wille unterstellt, nämlich sich von der Richtung her dem Schiff zu zu wenden.
Bezeichnend ist, dass die dritte Zeile dann das Motiv der Abwärtsbewegung noch einmal aufnimmt, diesmal verbunden mit der Landung eines Kranichs.
Insgesamt also ein starker Einstieg, der Phänomene der Natur in eine enge Verbindung zum Menschen bringt beziehungsweise sie aus seiner Sicht präsentiert.
Die Wirkung der Natur scheint so groß zu sein, dass sogar ein typisches Element der Großstadt, nämlich ein Baukran, sich auf diese für Menschen typische Weise auf die Natur einstellt und lauscht. Das Adverb „im Stillen“ macht dann noch einmal deutlich, wie sehr hier die Natur Vorrang hat vor dem, was man normalerweise mit Großstädten verbindet. Hier wird geradezu ein Gegenprogramm entwickelt gegenüber dem, was man etwa mit New York verbindet: der Stadt, „die niemals schläft“.
Strophe 2
Zu Beginn der zweiten Strope hat man zumindest kurzzeitig eine Gegenbewegung, denn ein Fisch erhebt sich dort über die Fläche des Sees. Aber man weiß natürlich, dass daraus auch gleich eine Landung werden wird.
Ab der zweiten Zeile verändert sich das Verhältnis von Großstadt und Natur in Richtung Gleichgewicht. Allerdings wird dem Mobiltelefon und den Grillen dasselbe Verb zugeordnet, das eher zur Natur gehört.
Bei der dritten und vierten Zeile der zweiten Strophe weiß man nicht gleich, ob damit Kritik angedeutet werden soll – nach dem Motto: Die Welt der modernen Kommunikation macht vor keinem stillen Paradies Halt.
Von daher ist man gespannt auf die beiden Terzette (Strophen mit nur drei Zeilen), die nach den beiden eher beschreibenden Quartetten häufig eine Schlussfolgerung präsentieren.
Strophe 3
Die dritte Strophe geht dann offensichtlich auf die Situation des lyrischen Ichs ein. Interessant ist die Abweichung von der normalen Formulierung: „bis zur Besinnungslosigkeit“. Hier soll also offensichtlich angedeutet werden, dass man an diesem See nicht nur Sonne bekommt, sondern auch zur Besinnung kommt.
Die Perspektive des lyrischen Ichs wendet sich dann einem schwarzen Schwan zu und einem Fischschwarm, bei dem man nicht weiß, ob er möglicherweise zu seinem Schutz „auseinanderspritzt“. Auf jeden Fall kommt hier zum ersten Mal Hektik in das Gedicht hinein.
Strophe 4
Das wird aber in der letzten Strophe nicht aufgenommen, sondern dort wird wieder eine sehr ruhige Langzeitperspektive präsentiert, was die Zukunft eines Baums angeht.
Erstaunlicherweise werden der Weide Geräusche zugeordnet, die wohl nicht von ihr selbst kommen. Es soll wohl angedeutet werden, dass dieser Baum mit seiner Rinde vielen kleinen Lebewesen Lebensraum gibt.
Das lyrische Ich empfindet das als Abschiedsgruß und stellt nur noch sachlich fest, dass sich sein Weg wohl gabelt. D.h. entweder, dass er sich dort entscheiden muss, oder aber, dass sein vorgegebenes Ziel von diesem See wegführt.
Gesamteindruck – Aussagen
Insgesamt ein Gedicht, das sehr persönliche Eindrücke präsentiert, die man in einer Großstadt an einem See bekommen kann, der viel Natur präsentiert und mit seiner Stille auch zumindest kurzzeitig eine Alternative zur sonst herrschenden Betriebsamkeit bietet.
Insgesamt begnügt dieses Gedicht sich mit Beschreibungen beziehungsweise Schilderungen, die zum einen Naturelemente intensiv wahrnehmen und Elemente der städtischen Welt in diese Welt des Sees integrieren. Nur an einer Stelle könnte man annehmen, dass das Nebeneinander von Technik und Natur zu einer Störung führen kann. Das Verständnis bleibt aber dem Leser überlassen.
Am Ende steht die möglicherweise bewundernd gemeinte Achtung vor der Größe der Natur und vielleicht auch ein bisschen Trauer, dass man sie jetzt verlassen muss.
Spontane Reaktion einer Schülerin auf das Gedicht
Dies nur als Anregung, sich einmal anders mit einem Gedicht zu beschäftigen, als gleich eine Checkliste abzuarbeiten – mit der Spitzenstellung der „sprachlichen Mittel“ 😉
Persönliche Erst-Reaktion von Mia:
- Ich finde schön, wie das Gedicht zeigt, dass es selbst in der Stadt Natur gibt.
- Lustig und ein bisschen ungewohnt, dass Handys und Grillen gleichgestellt werden.
- Die Bilder, die entstehen – zB das tanzende Blatt oder der schwarze Schwan – sind sehr klar.
- Das Ende mit der Weide wirkt melancholisch, regt mich zum Nachdenken an.
- Für mich ist die Mischung aus Technik und Natur sehr gelungen und modern.
- Der Ausdruck „SMS-Postillen“ klingt altmodisch und modern zugleich, das hat mich rascht.
- Den Fischschwarm und den Sprung des Plötz‘ konnte ich mir richtig gut vorstellen.
- Der Baukran, der „lauscht“, ist ein cooles Bild – Maschinen werden schnell lebendig.
- Vielleicht könnte man im Unterricht eigene Gedichte schreiben: „Natur in der Stadt heute“.
- Insgesamt gefällt mir das Gedicht, weil es entspannt wirkt und trotzdem tiefgründig ist.
 Tipp: Hier gibt es Zusatzpunkte
Tipp: Hier gibt es Zusatzpunkte
Einfach mal die Frage stellen
Die Erwähnung des Mobiltelefons: Ist das eigentlich Kritik oder macht es vielleicht sogar eine neue Harmonie zwischen Großstadt und See bzw. Natur deutlich.
Zur Frage der Zusatzpunkte bekommt man hier Tipps und Hilfen:
- Infos, Tipps und Materialien zum Thema „Zusatzpunkte“
https://schnell-durchblicken.de/zusatzpunkte-in-klausuren-wie-erreicht-man-sie-fach-deutsch
Und Folgendes könnte man bei einer Antwort bedenken:
Antwortidee zur Frage („Mobiltelefon – Kritik oder Harmonie?“):
-
Textbezug herstellen: In Vers 6 heißt es: „Im Grase zirpen Mobilfon und Grillen.“ Auffällig ist die direkte Verbindung: Das Handy wird in denselben Lautzusammenhang wie die Grillen gestellt.
-
Deutungsmöglichkeit 1 (Kritik): Man könnte dies kritisch lesen – das technische Geräusch stört das „natürliche Konzert“ von Grillen, Kranich, Wasser und Wind. Dann wäre das Mobiltelefon ein Fremdkörper, der die Idylle stört und eine Ironisierung der Naturlyrik herbeiführt.
-
Deutungsmöglichkeit 2 (Harmonie): Ebenso gut kann man aber betonen, dass der Dichter die Geräusche gleichwertig nebeneinanderstellt. Es heißt nicht „trotz“ oder „gegen“, sondern schlicht „und“. Das legt eine gewisse Gleichberechtigung nahe: Handy und Grillen zirpen gemeinsam, die moderne Kommunikation („SMS-Postillen“) ist Teil des Naturraums geworden. Die Großstadt und die Natur verweben sich – fast wie im Netz (V. 8: „Als wären Strauch und Strand ins Netz gewebt“).
-
Abwägung: Je nach Leseweise kann die Stelle also entweder als kritischer Kontrast oder als neue Form von Harmonie verstanden werden. Besonders spannend ist, dass die Formulierung bewusst mehrdeutig wirkt und die Lesenden zur Stellungnahme herausfordert.
-
Zusatzpunkt-Trick: Wer betont, dass das Gedicht insgesamt eine Balance sucht (Natur + Technik, Großstadt + See), kann argumentieren, dass das Handy gerade kein Fremdkörper ist, sondern Teil einer erweiterten modernen Idylle. Damit wird Naturlyrik aktualisiert: Nicht nostalgisch entrückt, sondern offen für heutige Lebenswirklichkeit.
Weiterführende Hinweise
- Themenseite „Gedichte“
https://www.einfach-gezeigt.de/themenseite-gedichtinterpretation
— - Themenseite „Analysieren und Interpretieren“
https://www.einfach-gezeigt.de/themenseite-analysieren-interpretieren
— - Weitere Liebesgedichte sind hier aufgelistet.
https://www.schnell-durchblicken2.de/liebesgedichte-sammlung - Weitere Reisegedichte finden sich hier:
https://textaussage.de/reisegedichte - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier.
- Eine Übersicht über unsere Videos auf Youtube gibt es hier.
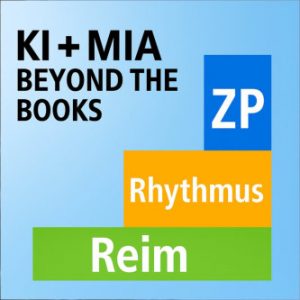 Weiter unten geben wir einen
Weiter unten geben wir einen